Familiengeschichten aus der KURIER-Redaktion: Als wieder Frieden war

Josef Emminger war ein Kleinkind, als klar wurde: Sein jahrelang vermisster Vater, den er nie kennengelernt hat, ist im Krieg gefallen.
Als die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 1945 bedingungslos kapitulierte und der Zweite Weltkrieg in Europa endete, war die Zeit der Ungewissheit noch lange nicht vorbei. Die Menschen bangten um die politische Zukunft, den Wiederaufbau, die nächste Mahlzeit.
Auf der politischen Weltbühne ging es nach der Befreiung von den Nationalsozialisten um die Aufteilung Österreichs und die Wiederherstellung der Republik. Eine provisorische Regierung nahm bereits am 27. April ihre Arbeit auf.
Die Menschen kämpften für den Neubeginn. Für viele Familien ging es zunächst darum, wieder zueinanderzufinden. Und falls das nicht mehr möglich war, den Verlust zu verkraften. Während des Zweiten Weltkriegs hatten etwa 1,2 Millionen österreichische Soldaten in der Wehrmacht gekämpft, rund 250.000 waren gefallen, 490.000 gerieten in Kriegsgefangenschaft. Insgesamt kamen zwischen 1938 und ‘45 über 60 Millionen Menschen ums Leben, sechs Millionen Juden wurden ermordet. Die Aufarbeitung der Traumata dauert in vielen Familien bis heute an.
Im Rahmen der Serie „80 Jahre II. Republik“ erzählen Redakteurinnen und Redakteure des KURIER ihre persönlichen Familiengeschichten aus der Nachkriegszeit – überliefert in Briefen, Tagebüchern und persönlichen Gesprächen. Es sind Berichte über Hunger, Heimkehr und zaghafte Hoffnung.

Stefanie und Lisa Hübner auf dem Rosenhügel in Liesing: Im letzten Kriegswinter lag so viel Schnee, dass sie sich mit Ski fortbewegten.
von Konrad Kramar
Mein Großvater Hugo, ein Wiener Sozialdemokrat, wurde im Winter 1944 noch einmal an die Front geschickt, in die Grenzregion zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Das Bild oben zeigt meine Mutter Lisa und meine Großmutter Stefanie in diesem letzten, besonders kalten Kriegswinter bei der Arbeitersiedlung Rosenhügel in Hetzendorf, die mein Urgroßvater miterbaut hatte. Damals lag dort so viel Schnee, dass man sich auf Skiern fortbewegen konnte.
Mein Großvater wurde wenige Wochen später gefangen genommen – und zwar, wie man in unserer Familie später oft erleichtert erzählte, von den Amerikanern. Wie ihm das gelang, ist bis heute unklar, schließlich kämpfte in dieser Gegend die Rote Armee. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die in unserer Familienchronik der letzten Kriegstage rätselhaft erscheinen. So erinnerte sich meine Oma immer mit Schrecken daran, dass ihr Mann als SPÖ-Mitglied in diesen letzten Kriegstagen nicht in die Wehrmacht, sondern in die SS eingezogen worden war. Vermutlich ein Racheakt an einem politischen Gegner.
Auf jeden Fall landete mein Opa in einem US-Kriegsgefangenenlager in Oberösterreich, wo er über Monate interniert war. Bis heute wundere ich mich darüber, wie meine Großmutter dieses Lager ausfindig machen konnte und wie sie es schaffte, mit meiner Mutter – damals gerade mal neun Jahre alt – unbeschadet dorthin zu gelangen. Meine Oma erzählte später jedenfalls, dass sie auf dem langen Weg nach Oberösterreich mehrfach die Zonengrenze zwischen den Besatzungstruppen überqueren musste, obwohl ihre Dokumente dies gar nicht erlaubten. Mit eisernem Willen gelang es den beiden, das Lager zu erreichen. Das tagelange Ausharren am Lagerzaun machte sich letztlich bezahlt und sie entdeckten meinen Großvater unter den schwer gezeichneten Gefangenen. Er habe so schlecht ausgesehen, dass sie ihn kaum wiedererkannt habe, erzählte meine Oma später. Erschöpft, aber unendlich erleichtert riefen die beiden so lange seinen Namen, bis er auf sie aufmerksam wurde. Durch den Zaun reichten sie ihm alles, was sie zuvor an Essen mühsam zusammengepackt hatten.

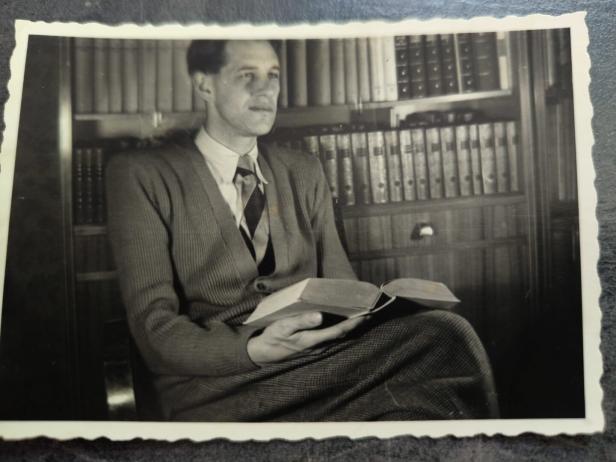



Kommentare